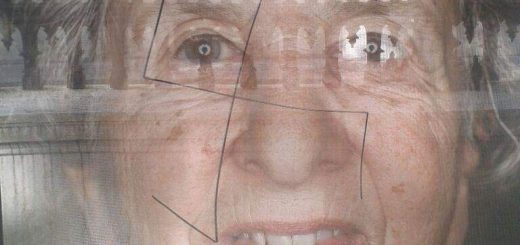Wenn man Birgit Kelle Glauben schenkt, dann wird die sogenannte westliche Welt von einer schrecklichen Plage heimgesucht: dem sogenannten GenderGaga. Sollten Sie bei Gaga zunächst an Freddie Mercury oder Stefani Germanotta gedacht haben, muss ich Sie leider enttäuschen. GenderGaga ist ein beliebter Kampfbegriff des organisierten Antifeminismus. Die rechtskonservative Publizistin Kelle etwa nutzt ihn prominent in ihrer 2015 erschienenen Schrift „GenderGaga. Wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will“.

Was soll GenderGaga sein? GenderGaga, das sind für Birgit Kelle und ihre Mitstreitenden eine Menge Dinge: Kindergartenkinder, die sich anders kleiden, als sie es möchten, Anti-Diskriminierung- und Gleichstellungspolitiken und die Existenz transidenter Menschen, um nur einige prominente Beispiele zu nennen. Eine besondere Abneigung hegt Kelle auch gegen die Frauen- und Geschlechterforschung, auch Gender Studies genannt. Damit ist sie nicht alleine. Ich gebe Gender Studies in die Google-Suchmaske ein. „Sind Gender Studies wissenschaftlich?“, ist das erste Ergebnis, das der Algorithmus mir vorschlägt. Ich erweitere die Recherche und googele andere Fachrichtungen: Soziologie, Mathematik, Sportwissenschaften. Augenblicklich erscheinen Angaben zu dem jeweiligen Fach, der Dauer des Studiums, klassischen Arbeitsbereichen und Karriereaussichten auf meinem Display. Die Ergebnisse der Suche heben sich merklich von der vorausgegangenen ab. Sie suggerieren: Gender Studies sind keine wissenschaftliche Disziplin (wie andere).
Doch was sind Gender Studies überhaupt? Bevor wir uns wieder Frau Kelle und ihrem Gaga zuwenden, sollten wir uns der Beantwortung dieser Frage widmen. Die Antwort ist fast ernüchternd und bedauerlicherweise spielen ikonische Popgrößen und Gaga erneut keine tragende Rolle.
Die Frauen- und Geschlechterforschung ist ein historisch gewachsenes, interdisziplinäres Projekt, das sich erst in den letzten Jahrzehnten als eigene Fachrichtung etabliert hat. Im frühneuzeitlichen Europa bedurften Universitätsgründungen der Zustimmung der jeweiligen Landesherren und des Papstes. Europäische Universitäten waren für Jahrhunderte eine reine Männerwelt. Frauen wie die italienische Philosophin und Physikerin Laura Bassi, die 1733 als erste Professorin Europas an die Universität Bologna berufen wurde, stellten eine Ausnahme dar. Die ordentliche Zulassung zum Studium musste von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen wie rassifizierten Menschen weltweit erst erkämpft werden. Im deutschsprachigen Raum war die Schweiz das erste Land, welches das sogenannte Frauenstudium ab 1865 ermöglichte. Ein Jahr später wurden Frauen auch in der Habsburger Doppelmonarchie in Teilen zum Studium zugelassen. In Preußen war die reguläre Immatrikulation für Frauen mit einer Gesetzesänderung ab 1908 möglich. Institute verweigerten Frauen jedoch jahrelang weiterhin den Zugang, und der Ausschluss von Vorlesungen war eine gängige Praxis. Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden zudem viele Frauen in Deutschland und Österreich gegen ihren Willen aus dem Wissenschaftsbetrieb entlassen. Der Ausschluss von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen war jedoch keinesfalls ein europäisches Phänomen. Die US-amerikanischen Ivy-League-Universität Yale ließ zum Beispiel erst 1969 die ersten Studentinnen zu.
Die späten 1960er und 1970er Jahre waren weltweit eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Neben der Antikriegsbewegung, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA und Befreiungskämpfen kolonisierter Menschen formierten sich auch studentische Reformbewegungen an den Universitäten. Die Frauenhochschulbewegung entstand aus der „Studentenbewegung“ heraus, entwickelte sich aber unabhängig von und teilweise in Opposition zu dieser, da sie der Ansicht waren, die besondere Situation von Frauen werde von dieser nicht ausreichend berücksichtigt. Die Beteiligten kritisierten sowohl die Organisation der Hochschulen, die Frauen weiterhin strukturell benachteiligten, als auch die Wissensproduktion selbst, die Männlichkeit jahrhundertlang weitestgehend ungestört mit Menschlichkeit gleichgesetzt hatte. Die Aktivistinnen brachten ihre Überlegungen auch in die eigene Forschung ein. Dies war in gewisser Weise der Beginn der kritischen Geschlechterforschung.
Die Versuche der männlichen Vormachtstellung zu begegnen, sahen jedoch unterschiedlich aus. Während einige Wissenschaftlerinnen nach einer genuin weiblichen Perspektive suchten, die sie einem männlichen Blick in ihren Disziplinen entgegenstellen wollten, forderten andere Forschende die Infragestellung von Geschlecht selbst und der Annahme, es sei ahistorisch, ein reines biologisches Faktum und damit schicksalsweisend. Sie forderten, Vorstellungen von Geschlecht in ihrem jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontext zu betrachten, anstatt es als gegeben hinzunehmen.
Der Begriff Gender ist aus dem Englischen entliehen und betont diese soziale Dimension von Geschlecht. Diese unterschiedlichen Denktraditionen prägen die Forschung bis heute und spiegeln sich auch in aktivistischen Debatten. Die deutsche Bezeichnung Frauen- und Geschlechterforschung verweist auf das Spannungsverhältnis. Mit der dritten feministischen Welle setzte sich in Deutschland aber auch die Bezeichnung Gender Studies durch. Ich habe mich dazu entschieden, die Begriffe Geschlechterforschung und Gender Studies in diesem Text wie Synonyme zu behandeln.
Ende der 1980er Jahre hatten sich in vielen Disziplinen kritische Ansätze zur Erforschung von Geschlechtern und Geschlechterverhältnissen etabliert und sich inhaltlich weiter ausdifferenziert. Auch wenn die Geschichts-, Sozial- und Rechtswissenschaften prominente Ansätze lieferten, wäre es falsch, die Geschlechterforschung darauf zu reduzieren. So gibt und gab es immer auch Forschende in den Naturwissenschaften, die zur Geschlechterforschung beitrugen, wie die US-amerikanische Biologin Ruth Hubbard. Allerdings fehlte es im deutschsprachigen Raum vielerorts weiterhin an inneruniversitärer Infrastruktur, die die Bemühungen der unterschiedlichen Fachrichtungen und Ansätze miteinander verbunden hätte. An der Universität Wien wurde deswegen 1993 die „Interuniversitäre Koordinationsstelle für Frauenforschung und Frauenstudien Wien“ gegründet, Vorläufer des heutigen Referats Genderforschung. Im Wintersemester 1997/1998 entstanden an der Humboldt Universität zu Berlin und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg die ersten Studiengänge, die sich im deutschsprachigen Raum explizit mit kritischer Geschlechterforschung auseinandersetzten. In den letzten Jahrzenten ist die Disziplin langsam gewachsen. Allerdings ist Frauen- und Geschlechterforschung weiterhin eine relativ kleine und ressourcenarme Disziplin. Laut dem Portal „Datensammlungen Geschlechterforschung der Datenbank des Margherita-von-Brentano-Zentrums“ verfügten im Sommersemester 2023 173 Professuren an deutschen Hochschulen über eine Voll- oder Teildenomination in der Frauen- und/oder Geschlechterforschung. Dies entspricht einem Anteil von 0,3 Prozent. Zum Vergleich: 2022 gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik beispielsweise 6529 Professuren für Naturwissenschaften und Mathematik und 13145 für Bauingenieurwesen. In Österreich bestehen aktuell 22 Professuren im Bereich der kritischen Geschlechterforschung. Dies entspricht einem Anteil von 0,4 Prozent. In der Schweiz gibt sechs Professuren auf dem Gebiet.
Es würde mich nicht überraschen, wenn Sie den Anteil der Gender Studies an der Gesamtwissenschaft deutlich höher eingeschätzt hätten. Das kommt nicht von ungefähr. Teil der erfolgreichen, antifeministischen Agitation gegen die Frauen- und Geschlechterforschung ist eine verzerrte Darstellung ihres Einflussbereichs und Umfangs. So spricht die eingangs erwähnte Birgit Kelle etwa von einer „Gender-Industrie mit Tausenden Beschäftigten“.
Es ist nach unserem Exkurs in die Wissenschaftsgeschichte nun bedauerlicherweise doch noch einmal an der Zeit, zum organisierten Antifeminismus und seinem Gaga zurückzukehren. Kritik an den Gender Studies kommt nicht ausschließlich von explizit antifeministischen Akteur:innen. Ich möchte mich hier allerdings auf diese konzentrieren, da sie meiner Ansicht eine spezifische Erzählung produzieren, die sehr einflussreich ist. Doch was ist Antifeminismus überhaupt?
Den Begriff des Antifeminismus prägte die deutsche Feministin Hedwig Dohm bereits 1902 in Anlehnung an Antisemitismus in ihrer Schrift mit dem bezeichnenden Titel „Die Antifeministen“. Antifeminismus ist eine Brückenideologie, die Akteur:innen unterschiedlicher Weltanschauungen wie fundamental christliche Gruppen und säkuläre Maskulist:innen lose verbindet. Gemeinsam ist antifeministischen Akteur:innen, dass sie nicht nur an ein unveränderliches Geschlecht, sondern auch an eine natürliche Geschlechterordnung glauben, die damit einhergehe, und feministische Bestrebungen deswegen explizit ablehnen. Obwohl sie mit sogenannten Differenzfeministinnen wie Alice Schwarzer die Annahme eines vorbestimmten und unausweichlichen Geschlechts teilen, unterscheiden sie sich von Schwarzer zum Beispiel durch ihre Haltungen zu Homosexualität, die von den meisten Antifeminist:innen als pathologisch angesehen wird. Die Begründungslogiken reichen von einer strikten Interpretation religiöser Schriften bis zu verkürzten evolutionsbiologischen Darstellungen. Anders als die Antifeminist:innen, mit denen sich etwa Hedwig Dohm um 1900 auseinandersetzte, beanspruchen einige Autorinnen des zeitgenössischen Antifeminismus jedoch auch das Label „Feministin“ für sich, entleeren es jedoch inhaltlich. Diese Strategie ähnelt der rechter Populist:innen wie Donald Trump, die sich als die „wahren Demokraten“ bezeichnen, trotz traditionell antidemokratischer Positionen und Politiken. Bekannte Gesichter des organisierten Antifeminismus sind die AfD-Politikerin Beatrix von Storch und ihr Mann Sven von Storch, die katholische Aktivistin Hedwig von Beverfoerde und die selbsternannten „Männerrechtler“ Eckhard Kuhla und Gerhard Amendt.
Die antifeministische Abwertung der Gender Studies ist eingebettet in eine spezifische Erzählung, die ich am Beispiel einiger Aussagen der deutschen Hochschullehrerin Hildegard Stausberg skizzieren werde. Stausberg mokierte sich am 15.3.2015 in Die Welt über die Frauen- und Geschlechterforschung. In dem Artikel mit dem Titel „Hurra! Viele neue Jobs durch Gender-Terror“ beschreibt Stausberg angeblich das Gespräch mit einer Bekannten, deren Tochter Gender Studies studiere. Sie schreibt:
„Nachdem die gesetzlich fixierte Frauenquote nun weitflächig durchgesetzt würde, sei eine noch weiter in die Tiefe gehende ,Geschlechtergleichheit‘ das nächste große gesellschaftliche Vorhaben. So zumindest würden die Ziele des Gender-Mainstreaming an der Uni ihrer Tochter [Tochter von Stausbergs Gesprächspartnerin, Anmerkung d. A.] von den dortigen Dozenten vermittelt – und deshalb sei diese auch so optimistisch in Bezug auf ihre Zukunft. Wenn alles so weitergeht wie bisher, könnte sie recht behalten. Denn längst hat sich unsere mächtige Gender-Lobby eine veritable Vermarktungsindustrie aufgebaut. Jedenfalls gibt es 146 entsprechende Professuren an Universitäten – plus weiteren fünfzig an Fachhochschulen“.
Wir wollen Frau Stausberg trotz ihres saloppen Tonfalls beim Wort nehmen. Stausbergs Ausführungen sind ein gutes Beispiel für die antifeministische Erzählung, in der der kritischen Geschlechterforschung eine rein funktionale Rolle als „Vermarktungsindustrie“ zugeschrieben wird. Glaubt man antifeministischen Akteur:innen wie Stausberg, dann untergräbt eine mächtige feministische, oft auch homosexuelle Lobby westliche Staaten und zwingt alle öffentlichen Institutionen zur Implementierung von Politiken, die die vermeintlich natürliche Ordnung der Welt pervertieren und wehrhafte Männer durch eine „politische Geschlechtsumwandelung“ (Volker Zastrow) wahlweise symbolisch oder buchstäblich kastrieren. Das kann einem lachhaft vorkommen. Es ist jedoch die gleiche Begründung, mit der der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán den Gender Studies in Ungarn die Akkreditierung entzog.
Für eine Gruppe von Menschen, deren Anspruch unter anderem die Bewahrung der deutschen Sprache ist, schaffen seine Vertreter:innen eine erstaunliche Anzahl an Neologismen. Neben besagtem Gaga finden sich in den Schriften von Birgit Kelle, Volker Zastrow oder Hildegard Stausberg auch die Begriffe Gender-Wahnsinn, Gender-Fantasien, Gender-Lobby, Gender-Terror, Gender-Industrie und nicht zuletzt Gender-Ideologie. Ich bin mir sicher, wenn Sie regelmäßig konservative Tageszeitungen lesen, werden Sie weitere Gender-Neologismen finden. Rhetorisch wird mit der Unschärfe der Begrifflichkeiten gespielt und darunter eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene subsumiert. „Na, Sie wissen schon, worum es geht“, scheinen Kelle und Co den Lesenden zu sagen, „alles Verrückte halt, Gedöns, Dingsbums, all things gender“. Gender ist in dieser Verwendung eigentlich ein leerer Begriff. Er steht für alles und nichts. Anti-Genderismus ist eine beliebte rhetorische Strategie antifeministischer Akteur:innen. Zugute kommen ihnen dabei auch innerfeministische Grabenkämpfe wie die kurz angerissene Debatte über die soziale Bedeutung von Geschlecht und die Abwertung und den Hass, den Schwarzer und Co. transidenten Menschen öffentlich entgegenbringen.
Wir haben in Deutschland und Österreich eine lange Tradition des gesellschaftlichen Ausschlusses, nicht nur von Frauen, auch von queeren Menschen, von Menschen, die von Antiromaismus, Antisemitismus und Rassismus betroffen sind. In der antifeministischen Selbstdarstellung kämpfen mutige Traditionalist:innen gegen eine übermächtige „Gender-Lobby“, die ihnen das Wort verbietet. Bedenkt man, dass Stausberg lange Zeit Chefredakteurin aller Fremdsprachenprogramme der Deutschen Welle war, Amendt Soziologieprofessor, von Storch Politikerin auf deutscher Bundesebene mit solch illustren Vorfahren wie einem NS-Reichsminister und sich alle benannten Autor:innen ausführlich und andauernd äußern, scheint diese Selbststilisierung jedoch mehr als fragwürdig. Womit wir es vielmehr zu tun haben, ist eine Verkehrung historischer Realitäten und die konservative Mobilisierung gegen progressive Errungenschaften. Natürlich kann man Forschung kritisieren. Man kann es und man sollte es. Davon leben die Wissenschaften. Aber wenn Sie das nächste Mal über GenderGaga stolpern, fragen Sie sich vielleicht, was genau eigentlich kritisiert wird und von wem.
Der Text erschien in der STIMME Nr. 129/2023
Illustration: Fatih Aydoğdu
Fritzi M. wurde 1991 in Köln geboren und lebt in Leipzig. Sie arbeitet als Politikwissenschaftlerin und freie Autorin. Fritzi interessiert sich für Macht und Ohnmacht, Gewalt und den menschlichen Körper. Die eigene Biografie sieht sie als Ausgangspunkt des Schreibens; das Schreiben als Akt des Aufbegehrens. Schreiben ist für sie immer politisch.
Der Jahresschwerpunkt 2023 der Initiative Minderheiten “Wissenschaftsskepsis – Folgen für die Demokratie ” wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung (ÖGPB) gefördert.