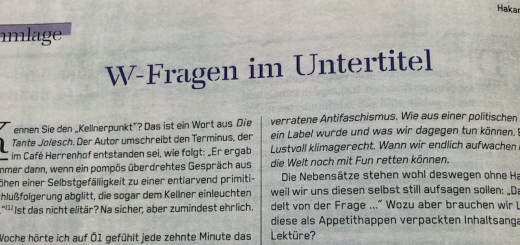Ich fürchte, ich habe es nie geschafft, weder in politisch guten noch in schlechten Zeiten, verbindende oder ermutigende Worte für meine Mitmenschen zu finden. Das hat wohl mit meinem Dissidentencharakter zu tun. Überall dort, wo ich auch nur einen Anflug von Einstimmigkeit und Gemeinschaftsgeist wahrnehme, versuche ich, diese zu zerstören, oder suche das Weite. Das ist wohl eine verwerfliche Eigenschaft. Ich kenne einige Menschen mit diesem Makel, sie gehen mir allesamt auf die Nerven. Im Laufe meiner Lebensjahre musste ich aber feststellen, dass ich in gewisser Hinsicht, jedenfalls in politischer, leider zu ihnen zähle.

Dabei ist mir bewusst, dass die Bildung einer Wir-Gruppe in Machtkämpfen die wesentliche Strategie darstellt. Hegemonie kann, so zumindest die Theorie, nur über Konsens hergestellt werden: zuerst in den eigenen Reihen, dann in der Gesamtgesellschaft („First we take Manhattan“ etc.). Das ist ja auch das Problem, das ich mit Theorien und politischen Strategien habe, die Hegemonie anstreben: Es ist fatal, Herrschaft übernehmen und sie zu „unseren“ Gunsten umfunktionieren zu wollen. Ich war stets davon überzeugt, dass es darauf ankomme, die Herrschaft abzuschaffen. Jüngere Zeiten und Menschen haben mich aber eines Besseren belehrt.
Worum geht es denn in einer sozialen Bewegung, kann man mir entgegenhalten, wenn nicht um die Umkehrung der Machtverhältnisse? Was bedeutet Empowerment sonst als Ermächtigung, als Aneignung der Macht? Worum ging es den sogenannten neuen sozialen Bewegungen seit den 1960er Jahren?
Ich würde meinen, um Rechte und Veränderung des Systems – ja und um Gesellschaftskritik. Mir ist schon klar, dass dieses Wort für jüngere Aktivist*innen nach Boomer, Glockenhose und Dieselmotor riecht. Zeugen wie Kant oder Spinoza wären da als sehr alte weiße Männer auch keine große Hilfe. Schon gar nicht Adorno, der immer so mansplainingsmäßig rüberkommt, etwa:
„Kritik ist aller Demokratie wesentlich. Sie wird durch Kritik geradezu definiert.“
Kritisch ist heute ein Wort, das vornehmlich als Versionsbezeichnung Anwendung findet, wie bei den Software-Upgrades: Wenn der Titel einer Disziplin oder einer Forschungsrichtung etwas zu verbeult klingt, wird das Adjektiv „kritisch“ an dessen Anfang gesetzt, und schon sind wir wieder Vorreiter*innen, auf der richtigen Seite und heutig. „Diskursanalyse“ etwa ist viel zu abgedroschen, voll Neunziger; gib Adjektiv, mach „Kritische Diskursanalyse“, und du bist nice! Von Kritischer Erwachsenenbildung über Kritische Medizin bis hin zu Kritischer Weißseinsforschung zieht sich eine Linie der sicheren Seite durch.
Was aber einst als mit historischem Blick verzahnte Analyse der Gesellschaft proklamiert wurde, scheint heute „keinen Sinn zu machen“. Ebenso die Definition der Kritik als Fähigkeit, die Gegenwart so zu beschreiben, dass diese Beschreibung einer Verurteilung der bestehenden Ordnung gleichkäme.
Kritik wurde in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend idiotopisch: Rechtfertigung und „Inhalt“ des kritischen Diskurses fundieren auf der jeweils eigenen Gruppe von Kritiker*innen. Die Gruppe hat Diskriminierung, Unterdrückung, Verfolgung und physische Gewalt erfahren, was sich zumeist in der Gegenwart fortsetzt. Dafür werden immerwährende Herrschaftsgruppen und Strukturen verantwortlich gemacht, auf die sich die Kritik auch richtet. Der kritische Diskurs lebt in dieser Variante von Zugehörigkeit; kritisch ist er allein dadurch, dass er von den Angehörigen der eigenen Gruppe geführt wird. Die wesentliche Frage lautet folgerichtig: „Wer spricht?“ Das Ziel der idiotopischen Kritik ist die Veränderung der Machtverhältnisse zugunsten des eigenen Kollektivs. Darum ist sie identitätspolitisch und identitätsstiftend ausgerichtet.
Wie man zu einer solchen Kritik und Politik steht, ist gegenwärtig die demokratiepolitische Gretchenfrage. Jedenfalls kehrt mit dieser Debatte ein Problem zurück, von dem ich dachte, wir hätten es bereits ausführlich genug diskutiert: Kultur. Anfang der 2010er Jahre, so meine Annahme, wurde gemeinhin manifest, dass diese zwar ein wichtiges Thema, aber ein „rutschiger“ Begriff ist, ähnlich wie Gott oder Freiheit, darum möge man sich wieder handfesteren Fragen zuwenden. Und nun kommt Kultur durch die Hintertür der Identität in den öffentlichen Diskurs zurück. Die sogenannten Kulturwissenschaften tragen daran meines Erachtens die Hauptschuld.
Die Kulturwissenschaften sind eine Graue-Literatur-Maschine. Jagd auf „blinde Flecken“ und „tote Winkel“ ist ihr Motor. Im Fünfjahresintervall entdecken kulturwissenschaftliche Abschlussarbeiten ausgesparte, übersehene oder aufgrund der „Positionierung“ der hegemonialen Betrachter*innen unsichtbar gewordene „issues“. Aktivist*innen stürzen sich sodann darauf und teilen die Welt neu ein: in jene, die wach, und jene, die privilegiert und daher unsensibel sind. Sujets, Figuren, zentrale Begriffe werden zu einem Paradigma verdichtet, und schon gilt das, was noch vor fünf Jahren en vogue war, als überholt und somit gegnerisch oder sogar feindlich.
Kulturwissenschaften sind der Laufsteg für wissenschaftliche Moden. Sie trugen überhaupt viel zur Fashionisierung des wissenschaftlichen Blicks bei. Man kann indes – in Anlehnung an Michel Foucaults berühmte Worte über Humanwissenschaften – die Prognose wagen: Die Kulturwissenschaften werden eines Tages Opfer der eigenen Modesucht werden. Die Mode will es so: Die Kultur wird verschwinden – wie ein Kleid nach der Präsentation auf dem Catwalk.
Die Kolumne “Stimmlage” erschien in der STIMME Nr. 128/2023
Hakan Gürses ist in der politischen Erwachsenenbildung tätig. Von 1993 bis 2008 war er Chefredakteur der Zeitschrift Stimme von und für Minderheiten, von 1997 bis 2011 Lektor und Gastprofessor für Philosophie an der Universität Wien. Seine Kolumne “Stimmlage” erscheint regelmäßig in der STIMME.