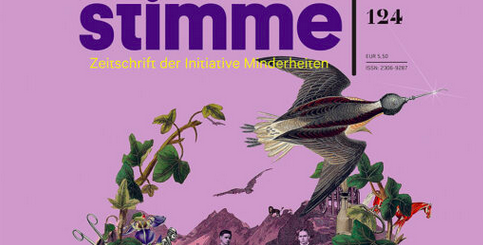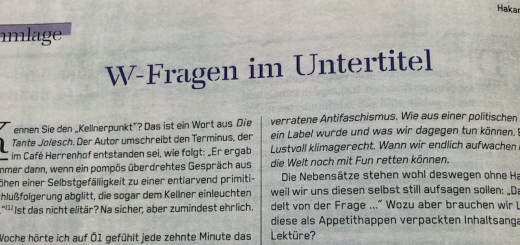Im März verstarb unser Kollege Erwin Riess. Einige Wochen zuvor hatte er an die STIMME-Chefredakteurin gemailt, dass er für die kommende Ausgabe krankheitsbedingt nicht schreiben werde, und sie um die Weiterleitung folgenden Wunsches an den Vorstand der Initiative Minderheiten gebeten: „Ich hoffe doch sehr, daß jemand über die Faschistenmachtübernehme in NÖ schreibt.“ Ich will hier versuchen, dieses Vermächtnis meines Freundes zu erfüllen. Zumindest einen Teil davon.

„Faschismus“ ist ein starkes Wort. Wahrscheinlich sogar in Bezug auf die neue Landesregierung in NÖ mit Udo Landbauer als Landeshauptfrau-Stellvertreter. Erwin Riess war aber nie verlegen um Worte, wenn es darum ging, rechte Tendenzen ohne jede Schönfärberei beim Namen zu nennen. Ich bin wohl weniger mutig bei meiner Wortwahl. Darum lege ich den Fokus auf die Frage, wie die FPÖ wieder einen Aufwind bekommen konnte.
Angesichts der inzwischen auch in Salzburg feststehenden Landesregierung in schwarz-blauer Konstellation stellt sich diese Frage umso dringlicher: Wieso wählen so viele Österreicher*innen nach all den Skandalen und Korruptionsfällen erneut die FPÖ? Nur einige Jahre nach der „Ibiza-“ oder der „Liederbuch-Affäre“? Trotz ihrer offenkundigen Ablehnung einer liberaldemokratischen Ordnung; ihrer ideologischen wie personalen Nähe zu autoritären Regimen und rechtsextremen Bewegungen; der rassistischen Aussagen, die sie augenzwinkernd von sich geben; und trotz ihrer mehrmals unter Beweis gestellten regierungspolitischen Unfähigkeit …
Auf diesen Fragenkomplex gäbe es – wenn man von der unpolitischen „Weil sie dumm sind“-Argumentation absieht – zwei logische Antworten. Die erste wird selten und eher hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen: „Die Leute wählen die FPÖ, weil diese ihre Ideologie vertritt. Dieses Land hat sich vom Nationalsozialismus nie ganz befreit.“
Diese Annahme ist gewagt, weil sie einen hohen Prozentsatz der Bevölkerung nur aufgrund des Wahlverhaltens pauschal mit einer – auch juridisch verbotenen – Gesinnung in Verbindung bringt. Es stimmt sicher, dass die FPÖ öffentlich genauso wie im sprichwörtlichen Keller gerne mit nationalsozialistischen Symbolen und Codes hantiert. Es stimmt auch, dass nicht wenige Mitglieder der Partei noch immer im antisemitischen und neofaschistischen Biotop gedeihen. Doch verkennt diese Annahme jene Veränderungen, die seit 1945 sowohl im Gesamtgefüge als auch im politischen Spektrum der „westlichen“ Gesellschaften stattgefunden haben. Somit auch die Tatsache, dass wir es nicht nur mit einem österreichischen Einzelfall zu tun haben.
Die zweite Annahme setzt beim Gegenpol an: Die Leute wählen die FPÖ gerade deswegen, weil sich etwas seit 1945 geändert hat. Worin diese Transformation bestehen mag, wird allerdings unterschiedlich diagnostiziert. Die Schlagwörter reichen von „Modernisierungsverlierer*innen“, deren Angst sich in Protestwahl entlade, bis hin zu „neuen Unterschichten“, die wegen ihrer kulturellen Missachtung durch die Eliten zum Votum als Rache greifen würden.
Solche Erklärungsmodelle sind im sozialpsychologischen Rahmen der Wahlmotivforschung sicher wertvoll. Wenn wir indes den Blick von Wähler*innen auf die Parteien verschieben, fällt da eine politische Strategie auf. Bei anderen Gelegenheiten habe ich diese Strategie rechtsextremer Parteien als Simulation des Klassenkampfes beschrieben.
Der soziale Friede in den Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit erfuhr seine Konsolidierung vor allem in einer Konsens-Demokratie, welche die auf Klassenkampf fußende Politik vergangener Jahrzehnte schrittweise zähmte. Die jährlichen Lohnrunden blendeten allmählich den als unversöhnlich geltenden Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit aus. Der Wille zur Versöhnung verlangte den Klassen-Parteien Deradikalisierung und gegenseitige Annäherung ab. Je mehr sich der Konsens stabilisierte, desto mehr ähnelten einander die sozialistischen und die bürgerlichen Parteien in ihren Programmen, Strategien und Vorfeldorganisationen.
Versöhnung, Konsens und runder Tisch funktionieren aber eher in Zeiten der Hochkonjunktur als Zauberformeln. Schon ab den Wirtschaftskrisen der 1970er und 1980er Jahre wurden die Rufe nach Arbeitskampf wieder laut. Da das Versprechen, Wohlstand sei auch ohne Kampf zu erreichen, nicht mehr realistisch schien, ergab sich als logische Folge der Wille zum Kampf. „Die Politik interessiert sich nicht für unsere Probleme!“ – die Konsens-Verdrossenen signalisierten mit diesem Satz, dass sie bereit seien für die Wiederaufnahme des Klassenkampfes. Dazu waren aber die Großparteien inzwischen weder willens noch fähig – sie bildeten nun auch als „System“ den eigentlichen Gegner der Kampfbereiten.
„Rechtspopulistisch“ genannte Parteien wie FPÖ, AfD oder FN erkannten die Lage besser und schafften es, den herbeigesehnten Klassenkampf zu simulieren (den echten zu führen, stand weder in ihrem Interesse noch in ihrem Programm). Es gelang ihnen, den selbst propagierten nationalistisch-rassistischen Abwehrkampf „unseres Volkes“ gegen die „Fremden“ in Begriffe, Bilder und Symbole des Klassenkampfes zu kleiden. Die Simulation des Klassenkampfes verläuft seit gut vier Jahrzehnten zwischen „uns“ Abgehängten und „denen“, den Zugewanderten, Geflüchteten – jenen, die kaum mehr zu verlieren haben als ihre Ketten. Paradoxerweise macht sie just dieses Kennzeichen der ehemaligen Habenichtse zum aktuellen Feind, den die „Systemparteien“ vermeintlich schützen und fördern würden. So können auch Parteien wie die FPÖ lautstark behaupten, sie seien die neuen Arbeiterparteien.
Um den stetigen Aufstieg dieser Parteien aufzuhalten, müsste logisch betrachtet zweierlei geschehen: Erstens müsste man überzeugend darstellen, dass sie keinen (Klassen-)Kampf für die Interessen der Abgehängten, der Wutbürger*innen, der „kleinen Leute“ führen. Zweitens müsste es eine Partei geben, die wirklich deren Interessen vertritt.
Vielleicht findet dann das Vermächtnis meines Freundes Erwin Riess seine Erfüllung.
Die Kolumne “Stimmlage” erschien in der STIMME Nr. 127/2023.
Hakan Gürses ist in der politischen Erwachsenenbildung tätig. Von 1993 bis 2008 war er Chefredakteur der Zeitschrift Stimme von und für Minderheiten, von 1997 bis 2011 Lektor und Gastprofessor für Philosophie an der Universität Wien. Seine Kolumne “Stimmlage” erscheint regelmäßig in der STIMME.