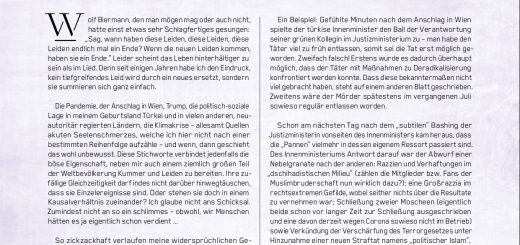Kennen Sie den „Kellnerpunkt“? Das ist ein Wort aus Die Tante Jolesch. Der Autor umschreibt den Terminus, der im Café Herrenhof entstanden sei, wie folgt: „Er ergab sich immer dann, wenn ein pompös überdrehtes Gespräch aus den Höhen einer Selbstgefälligkeit zu einer entlarvend primitiven Schlußfolgerung abglitt, die sogar dem Kellner einleuchten mußte.“[1] Ist das nicht elitär? Na sicher, aber zumindest ehrlich.

Diese Woche hörte ich auf Ö1 gefühlt jede zehnte Minute das Wort „Narrativ“, egal ob gerade ein Buch vorgestellt wurde oder eine der unendlichen Mozart-Berieselungen lief. Überhaupt geistert dieser philosophisch-sozialwissenschaftliche Begriff seit einigen Jahren in allen Medien. Würden wir pro „Narrativ“ in einer Zeitung, im Funk oder Fernsehen 50 Cent in eine Büchse werfen, bräuchten wir kein Licht-ins-Dunkel mehr (ob wir es überhaupt brauchen, ist eine andere Frage). Der Begriff wird freilich schon lange nicht mehr im ursprünglichen Sinn gebraucht (Lieblingsstehsatz dazu: „Die Sprache verändert sich ständig, und das ist gut so!“), dass nämlich auch jede Theorie nichts anderes sei als eine „große Erzählung“ (so Lyotard in Das postmoderne Wissen[2]). Die derzeitige Semantik von „Narrativ“ verweist eher auf einen ablenkenden, manipulativen Versuch, erzählend mythische Realitätsgebäude zu schaffen. Wenn jemand eine Aussagereihe als Narrativ bezeichnet, will er/sie* zumeist andeuten, dass er/sie* den Erzähltrick schon durchschaut hat. Der wissenschaftliche Terminus ist im Alltag angekommen, der Kellnerpunkt des Wortes ist erreicht.
Na und? „Die Sprache verändert sich ständig, und das ist gut so!“ Meine Generation hatte den „Diskurs“ als Kaugummi; die nächste „dekonstruierte“ alles, was ihr in die Hand und ins Blickfeld geriet – jetzt haben wir eben das „Narrativ“. Kellnerpunkt ist Kellnerpunkt, es kömmt nicht auf den Kellner an! Da ist aber doch etwas mehr an der Sache. Etwas vom Zeitgeist.
Fällt es Ihnen auch auf? Es erscheint kaum ein Sachbuch mehr ohne einen Untertitel, der die „Fragestellung“ des Werkes vorausschicken soll. Dem meist reißerischen Titel folgt bereits auf dem Buchcover ein Satz mit sogenannten W-Fragewörtern (etwa: wie oder was). Diese Untertitel werden aber nicht als klassische W-Fragen formuliert, die gewöhnlich mit einem Fragezeichen enden und auf die fast immer mit einem Wort geantwortet werden kann (etwa: Ja oder Nein). Sie sind wie indirekte Fragesätze gebaut, also Nebensätze mit dem Prädikat am Ende des Satzes, auch Pronominalsätze genannt – nur, dass es sich bei diesen Untertiteln nicht um Nebensätze, sondern um Hauptsätze handelt. (Ich weiß zu meinem Entsetzen nicht, wie die korrekte Bezeichnung dieser Satzform in der Grammatik lautet.)
Beispiele? Hier einige fiktive, um die wirklichen nicht zu diskreditieren: Das mutige Dagegenhalten. Wie man gegen Schwurbler argumentiert, ohne dabei den Anstand zu verlieren. Oder: Der verratene Antifaschismus. Wie aus einer politischen Bewegung ein Label wurde und was wir dagegen tun können. Ein letztes: Lustvoll klimagerecht. Wann wir endlich aufwachen und wie wir die Welt noch mit Fun retten können.
Die Nebensätze stehen wohl deswegen ohne Hauptsatz da, weil wir uns diesen selbst still aufsagen sollen: „Das Buch handelt von der Frage …“ Wozu aber brauchen wir Leser*innen diese als Appetithappen verpackten Inhaltsangaben vor der Lektüre?
Klar, täglich erscheinen tausende Bücher. Verlage wollen mit ihren Erzeugnissen auffallen. Aber wenn sie alle dieselbe Untertitelstrategie verfolgen, fallen sie ja erst recht nicht auf. Vielleicht nehmen die Verleger*innen an, dass die Menschheit ihnen unter der Hand verblödet und das Buchthema ohne Voraushilfe nicht erkennt. Oder ist es die kollektive Sehnsucht, alle Bücher in Ratgeber-Literatur zu verwandeln und das Verlagswesen in eine Lifecoach-Anstalt? Kann es sein, dass wiederum eine Form von quasi-positiver „Trigger-Warnung“ am Werk ist, nur diesmal als Verkaufstaktik? Weiterer Gedanke: Es gibt keinen Anspruch auf streng systematische Theorieentwürfe mehr und auch keine Nachfrage danach. Welterklärung möge in einem Nebensatz erfolgen, die „großen Erzählungen“ sind passé.
Womit wir wieder beim „Narrativ“ gelandet sind und beim Kellnerpunkt.
Nachbemerkung: Die Produktion einer NGO-Zeitschrift dauert naturgemäß lang. Darum kann ich nicht wissen, wie die aktuelle Weltlage aussehen wird, wenn Sie diese Stimmlage lesen. Im Moment ist der Militärangriff Russlands auf die Ukraine voll im Gange. Mein Thema für die Kolumne stand indes bereits länger fest. Über diesen relativ unbedeutenden Gegenstand zu schreiben, fiel mir angesichts der eigenen Gefühlskonstellation (Ohnmacht, gemischt mit Wut und Teilnahme) schwer. Was aber sollte ich denn über den Krieg schreiben – außer, dass ich dagegen bin? Analysieren können ihn Kenner*innen der „Materie“ tausendfach besser als ich, was sie eh schon seit Tagen tun.
Ich gehöre auch nicht zu denen, die aus Solidarität das eigene Facebook-Profilbild mit einer Nationalfahne schmücken, wie schlimm es dieser Nation gerade auch gehen mag. Fahnen sind Bojen für Kriegsschiffe, auch in Zeiten des Friedens. Ich kann nicht Partei ergreifen in einem Krieg, wiewohl mein Mitgefühl natürlich der leidenden Bevölkerung der Ukraine gilt, denen, die geflüchtet sind, ebenso wie denen, die bleiben mussten – sowie jenen Menschen in Russland, die auf der Straße gegen den Krieg protestieren, Petitionen unterschreiben, ihre berufliche Funktion niederlegen, auf die naheliegende Gefahr hin, verhaftet und misshandelt zu werden.
Das Einzige, was ich im Moment hoffen kann, liebe*r Leser*in, ist, dass das verordnete und legalisierte Töten schon vorbei sein wird, wenn Sie diese Zeitschrift in den Händen halten. Dann kann ich wieder über meine armselige Kolumne lächeln und sogar ein Schäuferl Witz nachlegen: „Neuester Buchtitel – Der Traum vom Frieden. Wie wir Kriege für immer meiden können und wie die Aggressoren für immer zu stoppen sind.“ Tja!
[1] Friedrich Torberg: Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Tosa Verlag: Wien 1995, S. 165.
[2] Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Passagen Verlag: Wien 1994.
Die Kolumne “Stimmlage” erschien in der STIMME (Nr. 122/2022).
Hakan Gürses ist Wissenschaftlicher Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB). Von 1993 bis 2008 war er Chefredakteur der Zeitschrift Stimme von und für Minderheiten, von 1997 bis 2011 Lektor und Gastprofessor für Philosophie an der Universität Wien. Seine Kolumne “Stimmlage” erscheint regelmäßig in der STIMME.